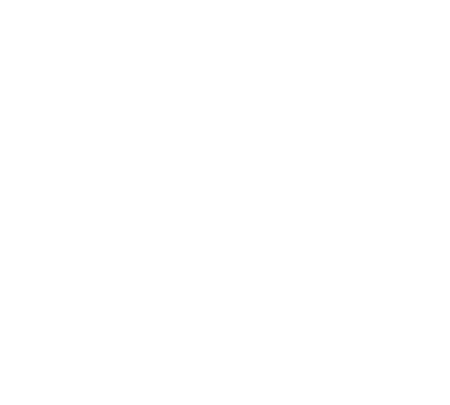Das 3. Sinfoniekonzert am 27. und 28. Februar 2025 fällt aus dem Rahmen. Unter der musikalischen Leitung von Gastdirigent Joseph Bastian ist Hans Zenders moderne Version von Schuberts berühmtem Liederzyklus Winterreise zu erleben. Mit Daniel Behle konnte einer der gefragtesten Tenöre für Lied, Konzert und Oper gewonnen werden.
Eine eiskalte Winternacht, erstarrte Flüsse, schneebedeckte Felder – und ein Wanderer, der von der Liebe verlassen, völlig vereinsamt und gebrochen in dieser trostlosen Welt der Kälte umherirrt. Mit den Eingangsversen „Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus“ bringt Schubert in seiner Winterreise auf den Punkt, was für die Epoche der Romantik geradezu bezeichnend war: das ziellose Wandern, die Einsamkeit, die Suche nach der eigenen Identität – das alles hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Schuberts Winterreise scheint also eine zeitlose Komposition zu sein. Doch wie nehmen wir heute die Musik des Schubertschen Originals im Vergleich zur Zeit Schuberts wahr?
SCHUBERTS WINTERREISE: EINE ZEITLOSE KOMPOSITION?
Fast zwei Jahrhunderte liegen zwischen Schuberts Komposition und heute. Der Klang unserer Konzertsäle hat sich entwickelt, auch die Instrumente gleichen nicht mehr denen von damals. Und vor allem haben sich unsere Hörgewohnheiten verändert. Als Schubert seinen Freunden den „Zyklus schauerlicher Lieder“ vorzeigte, erlebten sie sie diesen als ungemein aufrüttelnd und modern. „Wird es möglich sein, die ästhetische Routine unserer Klassiker-Rezeption, welche solche Erlebnisse fast unmöglich gemacht hat, zu durchbrechen, um eben diese Urimpulse, diese existentielle Wucht des Originals neu zu erleben?“, fragte sich der Komponist Hans Zender (1936–2019). Seine Bearbeitung von Schuberts Winterreise, die er selbst als „komponierte Interpretation“ bezeichnete, verfolgt genau dieses Ziel. Unter den zahlreichen Schubert-Bearbeitungen ist seine Version mittlerweile ein Welterfolg, und hat sich seit seiner Uraufführung 1993 fest im Konzertrepertoire etabliert. Dabei ließ Zender die Liedmelodien weitgehend unangetastet, und verlegte den Klaviersatz auf Holz- Blechbläser, Schlagwerk, Harfe und Streichquintett, aber auch auf die „Folkloreinstrumente“ wie die Gitarre, Akkordeon und Mundharmonika (bzw. Melodica). Zender lässt dem Wanderer mit der Windmaschine den kalten Wind ins Gesicht peitschen, lässt durch Klopfen mit der Rückseite der Streicherbögen die klirrende Kälte hörbar spüren. Durch gewagte musikalische Eingriffe, Überzeichnungen und Klangeffekte gelang es ihm eindrucksvoll, der Winterreise ihre ungewohnte und schockierende Wirkung zurückzugeben.
ÜBER DANIEL BEHLE
Mit dem weltweit gerühmten Tenor Daniel Behle konnte ein Interpret gewonnen werden, der sich mit Schuberts Winterreise schon lange intensiv befasst. Seine Auseinandersetzung mit dem Liederzyklus reicht bis in die Komposition einer eigenen Fassung für Klaviertrio und Tenor. Für seine „MoZart“ Einspielung wurde er 2020 mit dem OPUS Klassik als „Sänger des Jahres“ geehrt. 2024 wurde ihm der Ehrenpreis der Deutschen Schallplattenkritik verliehen.
Eine eiskalte Winternacht, erstarrte Flüsse, schneebedeckte Felder – und ein Wanderer, der von der Liebe verlassen, völlig vereinsamt und gebrochen in dieser trostlosen Welt der Kälte umherirrt. Mit den Eingangsversen „Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus“ bringt Schubert in seiner Winterreise auf den Punkt, was für die Epoche der Romantik geradezu bezeichnend war: das ziellose Wandern, die Einsamkeit, die Suche nach der eigenen Identität – das alles hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Schuberts Winterreise scheint also eine zeitlose Komposition zu sein. Doch wie nehmen wir heute die Musik des Schubertschen Originals im Vergleich zur Zeit Schuberts wahr?
SCHUBERTS WINTERREISE: EINE ZEITLOSE KOMPOSITION?
Fast zwei Jahrhunderte liegen zwischen Schuberts Komposition und heute. Der Klang unserer Konzertsäle hat sich entwickelt, auch die Instrumente gleichen nicht mehr denen von damals. Und vor allem haben sich unsere Hörgewohnheiten verändert. Als Schubert seinen Freunden den „Zyklus schauerlicher Lieder“ vorzeigte, erlebten sie sie diesen als ungemein aufrüttelnd und modern. „Wird es möglich sein, die ästhetische Routine unserer Klassiker-Rezeption, welche solche Erlebnisse fast unmöglich gemacht hat, zu durchbrechen, um eben diese Urimpulse, diese existentielle Wucht des Originals neu zu erleben?“, fragte sich der Komponist Hans Zender (1936–2019). Seine Bearbeitung von Schuberts Winterreise, die er selbst als „komponierte Interpretation“ bezeichnete, verfolgt genau dieses Ziel. Unter den zahlreichen Schubert-Bearbeitungen ist seine Version mittlerweile ein Welterfolg, und hat sich seit seiner Uraufführung 1993 fest im Konzertrepertoire etabliert. Dabei ließ Zender die Liedmelodien weitgehend unangetastet, und verlegte den Klaviersatz auf Holz- Blechbläser, Schlagwerk, Harfe und Streichquintett, aber auch auf die „Folkloreinstrumente“ wie die Gitarre, Akkordeon und Mundharmonika (bzw. Melodica). Zender lässt dem Wanderer mit der Windmaschine den kalten Wind ins Gesicht peitschen, lässt durch Klopfen mit der Rückseite der Streicherbögen die klirrende Kälte hörbar spüren. Durch gewagte musikalische Eingriffe, Überzeichnungen und Klangeffekte gelang es ihm eindrucksvoll, der Winterreise ihre ungewohnte und schockierende Wirkung zurückzugeben.
ÜBER DANIEL BEHLE
Mit dem weltweit gerühmten Tenor Daniel Behle konnte ein Interpret gewonnen werden, der sich mit Schuberts Winterreise schon lange intensiv befasst. Seine Auseinandersetzung mit dem Liederzyklus reicht bis in die Komposition einer eigenen Fassung für Klaviertrio und Tenor. Für seine „MoZart“ Einspielung wurde er 2020 mit dem OPUS Klassik als „Sänger des Jahres“ geehrt. 2024 wurde ihm der Ehrenpreis der Deutschen Schallplattenkritik verliehen.